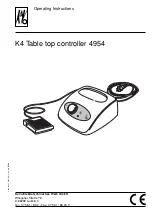DEUTSCH
87
1)
Mit dem 17 Schlüssel wird die Sechskantmutter
in der Position K gelockert und anschließend die
Riemenbremse so bewegt, dass dadurch der
nachstehenden Reihe nach zwei Bedingungen
entsehen:
a) die Entfernung X zwischen der Riemenbremse
und der Scheibe P (Abb. 8) muss zwischen 1
und 2 mm betragen.
b) Die Entfernung Y zwischen der Riemen-
bremse F und dem Riemen muss mit ange-
spannter Stange Q1 (1. Gang-Hebel ist betä-
tigt) zwischen 1,5 und 2,5 mm liegen.
2)
Wenn die Bedingungen a) und b) erfüllt sind,
kann die Mutter in der Position K angezogen
werden; dabei Acht geben, dass sich die Riemen-
bremse während des Vorgangs nicht verschiebt
(gegebenenfalls eine Zange oder anderes Werk-
zeug benutzen).
Nach der oben beschriebenen Einstellung der
Riemenbremse kann man das Riemengehäuse
wieder montieren, den Motor wieder anlassen,
die Hebel (1a, 2a und RM) einzeln betätigen und
loslassen und prüfen, ob der Riemen ganz ste-
hen bleibt.
Das findet statt, wenn man kein Knirschen oder
keine andere ungewöhnliche Geräusche zu hö-
ren sind. Gegebenfalls muss die der Regulier-
vorgang in sorgfältiger Weise wiederholt werden.
5.3.2 EINSTELLUNG DER FAHRHEBEL
Die Einstellung der Fahrhebel ist sehr wichtig, weil
diese die Leitrollen der Gangschaltung steuern, die
durch die Vorspannung verschiedener Riemen die
Maschine in Bewegung setzen.
Eine korrekte Einstellung der Fahrhebel und des Rück-
wärtsgangs erfolgt durch die Verlängerung der Feder
M1-M2-M3 Abb. 9 um 25
÷
28mm, wenn die entspre-
chenden Steuerungshebel auf der Sterze bis zum An-
schlagende betätigt worden sind (gestützt auf dem Griff).
Um dies zu erreichen, eventuell auf Gabel F1-F2-FR
Abb. 9 wirken.
N.B. Während der Bedienung der Maschine müssen
die Fahrhebel immer bis zum Anschlagende betätigt
werden (und sich auf dem Gummigriff stützen).
5.3.3 EINSTELLUNG DES RIEMENS FÜR DEN
FAHRTRICHTUNGSWECHSEL
Sollte sich ein Wechsel oder eine Regulierung des
Riemens, der für den Wechsel der Fahrtsrichtung
sorgt, als notwendig erweisen (Riemen, der AT mit
AR verbindet), soll folgenden Maßen vorgegangen
werden:
- Die Befestigungsschraube der Kurvenwelle AT, auf
dem die Feder montiert ist, lockern.
- Die Kurvenwelle drehen bis der Riemen richtig an-
gespannt ist.
- Die Befestigungsschraube der Kurvenwelle wieder
festschrauben.
Der Riemen ist korrekt angespannt, wenn bei einer
kräftigen Druckausübung mit einem Finger auf den
längeren Trum eine Biegung von 1 bis 2 mm er-
zeugt wird.
5.3.4 SEKUNDÄRGETRIEBE
Dieses Getriebe ist anhand des Schemas in der Ab-
bildung 10 veranschaulicht. Die Fünfrillen—Scheibe
P, die von den 1. Gang-, 2. Gang- und Rückwärtsgang-
scheiben in Bewegung gesetzt wird, verteilt diese
Bewegung an zwei Untersetzungsgetriebe mit endlo-
sen Schrauben mit Hilfe von zwei Riemen: einem am
rechten (dx) und einem am linken (sx) Untersetzungs-
getriebe.
5.3.5 KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES
SEKUNDÄRGETRIEBES
Die Fahrzeuglenkung erfolgt über die Auskupplung
des Riemens C1 oder C2 durch die Scheiben Pdx und
Psx (Abb. 11). Diese Riemen werden normalerweise
durch Leitrollen G1, G2, G3 und G4 mit Hilfe der Fe-
dern M1 und M2 in Spannung gehalten. Zum Rechts-
lenken genügt es, den Riemen C1 auszukuppeln und
S1 und S2 zu öffnen. Zum Linkslenken wird der glei-
che Auskupplungsvorgang durchgeführt und S3 und
S4 geöffnet. Die Vorrichtung kann als exakt reguliert
angesehen werden, wenn folgende Teile kontrolliert
worden sind:
a) Der Abstand zwischen unterer Riemenbremse und
den Scheiben (Abb. 10) soll d=2-3 mm betragen;
man muss dafür sorgen, dass die Riemen in nor-
malem Zustand (gespannt) nicht dagegen reiben.
b) Die Lager S1S2 und S3S4, die zwei Leitrollen tra-
gen, sollen, wenn sie in „normalem“ Zustand ge-
gen C1 und C2 gedrückt werden, so liegen, dass
AB gleich a=75mm ist, wobei A und B zwei Punkte
sind, an denen die Federn M1 und M2 Abb. 10
befestigt sind.
c) Bei zwei nacheinander durchgedrückten Hebeln
sollen sich die Kettenschuh der Scheibenbremse
W1-W2 Abb. 11 in die Scheibenrillen einfügen.
Dies geschieht, wenn man am Anschlagende die
Summary of Contents for F 400
Page 4: ...4 1700 900 700 Fig 2 A Fig 3 5 4 1 2 6 3 7 ...
Page 5: ...5 Fig 4 1 2 3 A B 6 4 5 1 4 2 Fig 5 Fig 6 1 3 5 ...
Page 6: ...6 2 A B 1 Fig 6 a Fig 7 AR AM P K AT R F1b V L G1 G2 P5 P2 P3 P4 Q P1 F GR ...
Page 9: ...9 Fig 13 1 6 4 3 2 2 5 Fig 12 F D1 M S A R RT V ...
Page 10: ...10 3 1 1 Fig 14 ...
Page 11: ...11 1 4 2 3 9 7 6 5 8 Fig 15 7 6 5 8 11 10 ...
Page 12: ...12 Fig 17 1 2 4 6 7 5 3 Fig 16 ...
Page 13: ...13 1 4 3 5 2 Fig 18 Fig 19 A A 9 10 9 6 5 2 2 1 7 3 4 8 13 11 12 F ...